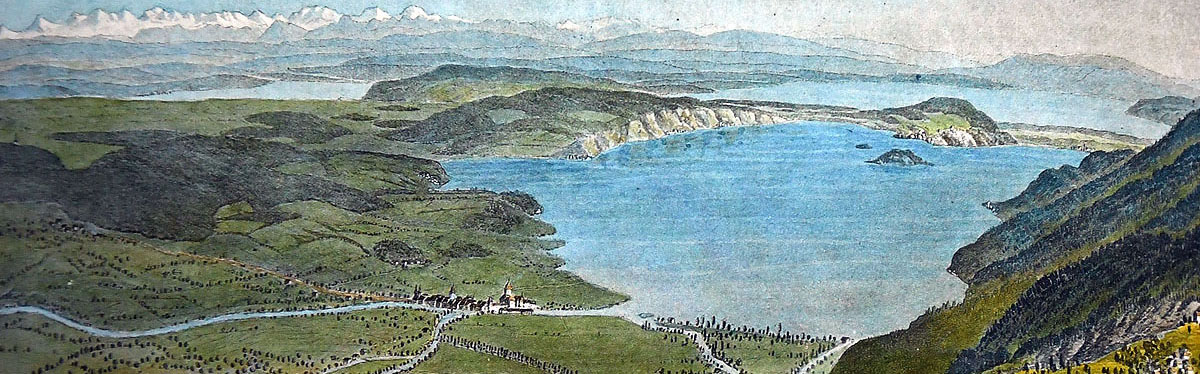Warum die Franzosen in unser Land einbrechen wollten und wie sie Freunde und Helfer gewannen – Peter Ochs und Cäsar Laharpe
Es war Ende des Jahres 1797. Die französischen Heere hatten auf dem Festlande gesiegt. Sie hatten den Österreichern nicht nur Belgien entrissen, sondern auch die Lombardei und aus ihr die sogenannte zisalpinische Republik gemacht. Das war ein Vasallenstaat Frankreichs. Nun faßte die französische Regierung, die damals aus fünf Männern bestand, den Entschluß, auch die Eidgenossenschaft zu erobern und zu unterwerfen. Warum? Wir wissen es. Die Franzosen wollten die Grundsätze der Revolution ausbreiten und ihre Macht vergrößern . Die Schweiz sollte Frankreich zudem als Durchgangsland dienen, wenn sich die Österreicher etwa wieder erhoben, um die Lombardei zurückzuerobern. Und endlich wußten die Franzosen, daß Bern einen gewaltigen Staatsschatz besaß. Nach diesem waren sie lüstern. Sie konnten ihn wohl gebrauchen; denn ihre Kassen waren leer.
Es war der französischen Regierung auch bekannt, daß es in der Schweiz Unzufriedene gab, und daß diese meinten, ihre «wahren Brüder» seien die Franzosen .Die Regenten Frankreichs schmunzelten Wir besitzen also Verbündete in der Schweiz; es gilt, noch mehr solche zu gewinnen.
Zu den Schweizern, die das neue Frankreich besonders leidenschaftlich bewunderten, gehörten der Basler Oberstzunftmeister, Peter Ochs, und der waadtländische Edelmann Friedrich Cäsar Laharpe. Beide waren Anhänger der Französischen Revolution. Ochs jubelte zum Beispiel: «Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das, was in Frankreich sich ereignet, mich entzückt, mich hinreißt, mich begeistert.»
Beide Männer stachelten ihre Mitbürger auf; beide begaben sich nach Paris, und beide riefen der dortigen Regierung, Truppen zu senden. Die Franzosen gewannen in unserem Lande aber auch zahlreiche kleine Freunde, Helfer und Helfershelfer. Da war zum Beispiel ein Utzenstorfer, namens «Fischer Sami›>. Dieser erklärte sich bereit, den Franzosen, wenn sie einmal einmarschierten, Straßen und Fußwege im Bernerlande zu weisen. Vorläufig fand er Unterschlupf beim französischen Gesandten in Basel.
Der Gemeindeobmann von Höchstetten, seines Zeichens Seifenfabrikant und Branntweinhändler, stand auch auf der Seite Frankreichs. Er war einst im «Gasthaus zur Waage» in Genf Stallknecht gewesen und erhielt nun von dort Briefe und revolutionsfreundliche Zeitungen.
Ein anderer Höchstetter ritt im Emmental herum und versuchte die Leute aufzuwiegeln.
In der Stadt Bern sehnte sich ein Teil der Regimentsfähigen «nach französischer Freiheit». Kurz, die eroberungslustigen Franzosen hatten in unserem Lande zahlreiche Anhänger, und so konnten sie es nicht nur von außen, sondern auch von innenher angreifen. . . «Die Axt war wirklich dem Baum an die Wurzel gelegt»
Letzte Warnungen
War es nicht doch noch möglich, im letzten Augenblicke das Vaterland zu retten? Einzelne Männer versuchten es, so Johannes von Müller und seltsamerweise ein Ausländer, nämlich der Wackere deutsche Arzt Johann Gottfried Ebel. Dieser Ebel hatte sich zwei Jahre in der Schweiz aufgehalten und sie ins Herz geschlossen. Nun lebte er in Paris. Zu seinen Patienten gehörten die einflussreichsten französischen Politiker. So vernahm er aus sicherer Quelle, was sie mit unserem Lande vorhatten. Im Spätjahr 1797 schrieb er Brief um Brief an den Bürgermeister von Zürich und an andere Freunde. Er ermahnte, er drängte, er beschwor sie:
Führt die notwendigen Neuerungen durch; nehmt die Untertanengebiete als gleichberechtigte, selbständige Orte auf; sorgt dafür, daß auch die Landleute studieren und Ämter bekleiden können und daß die Städter auf ihre bisherigen Vorteile in Handel und Gewerbe verzichten; denn «es kommt hier auf die Unabhängigkeit der Schweizernation an und nicht auf das Geldinteresse einiger hundert Familien».
Ebel erinnerte ferner daran, wie die Franzosen die besiegten Länder ausgeplündert und unterjocht hatten . Er warnte darum die Benachteiligten und die Neugesinnten dringend davor, die Franzosen herbeizurufen, um mit ihrer Hilfe die notwendigen Änderungen durchzuführen. Ja, er erklärte ausdrücklich: «Es ist toll und rasend, etwas Gutes in seinem Lande durch ein fremdes Volk bewirken zu wollen.»
Dann fuhr er fort: «Wenn ich in die Zukunft blicke und mir die Schweiz in den Klauen der Franzosen denke, so überfällt mich eine Seelentrauer, die ich noch nie kannte. - Retten, o retten Sie sich, derweil es noch Zeit ist. - Ich höre nicht auf, Lärm zu schlagen. Auf allen Hochwachten möchte ich Kanonendonner erschallen lassen, um jedes Schweizers Aufmerksamkeit zu wecken.»
In unserem Lande aber blieb alles beim Alten. Da schrieb Ebel, der später Schweizer Bürger wurde, voll Kummer: «Wehe, wehe über die edle Schweizernation, wenn ihre Führer und Väter so blind und schwach sind! Ich fange an zu verzweifeln.»
Die Franzosen senden Armeen ins Land, aber versichern, dass sie die Truppen zurückziehen werden, sobald Bern und Solothurn die Volksherrschaft eingeführt hätten
Die Franzosen waren überzeugt: Wenn Bern fällt, fällt die ganze Eidgenossenschaft. Deshalb entschlossen sie sich, all ihre Kraft gegen Bern zu richten. Mitte Dezember 1797 sandten sie ein Heer in die schweizerischen Teile des heutigen Berner Juras. Dieses besetzte das St.Immer, das Münstertal und Biel. Ochs hatte hiezu geraten. Bern unterhielt mit diesen Gebieten seit Jahrhunderten ein ewiges Burgrecht und war verpflichtet, sie zu schützen. Was tat es? Der Große Rat ernannte Karl Ludwig von Erlach zum General und bot einige wenige Truppen auf. Sie bezogen hauptsächlich in Aarberg, Nidau und Büren Quartier. Der Gemeindepräsident von Höchstetten aber berief überraschend eine Gemeindeversammlung ins Schulhaus und stellte den Antrag: Wenn die Franzosen weiter vorrücken, wollen wir uns nicht zur Wehr setzen, sondern einen Freiheitsbaum aufrichten; das Land wird dann nicht geplündert.
Die schweizerischen Freunde der Franzosen wollten das Vaterland also nicht verteidigen.
Ende Januar 1798 marschierte ein zweites französisches Heer in bernisches Gebiet ein, nämlich in die Waadt. Jetzt erließ Bern ein allgemeines Truppenaufgebot und ermahnte die Mitstände zur Hilfe.
Die Franzosen begehrten die Eroberung des Landes nicht allein mit Waffen durchzuführen. Sie entschlossen sich vielmehr, Bern zuerst mit haßerfüllten und verleumderischen Worten anzugreifen. Sie hofften: Die Untertanen werden es dann nicht mit Eifer verteidigen und die verbündeten Orte es nur lau unterstützen.
So verfaßte der französische Gesandte in Basel anfangs Februar verschiedene Schriftstücke und Proklamationen «an die wackeren Schweizer und besonders an die Berner» und ließ sie in deutscher und französischer Sprache massenhaft verbreiten. In diesen Kundgebungen hieß es:
«Eure Obrigkeiten betrügen euch, wenn sie mit frecher Stirne verkündigen, daß die französische Republik sich eures Bodens bemächtigen wolle. Das Direktorium (die französische Regierung, die aus fünf Männern bestand) hat niemals einen solchen Plan gefaßt. Die französische Republik kennt in Helvetien nur einen Feind, und dieser ist noch mehr der eurige. Es ist der Rat von Bern, dieser wahnsinnige Tyrann, der euch seit langem barbarisch unterdrückt und gegen Frankreich treulose und schändliche Ränke schmiedet.
Sobald Bern und Solothurn die demokratischen Grundsätze durchgeführt haben, werden die französischen Truppen sich zurückziehen und damit beweisen, daß es dem Direktorium nur darauf ankam, das schlechte Regiment eurer bisherigen Herren zu beseitigen. Dagegen wird es das Gebietund die Selbständigkeit des Schweizervolkes immer achten und seinen Staat als frei und unabhängig anerkennen.»
Die bernische Regierung kämpft nicht gegen den eingedrungenen Feind, sondern unterhandelt mit ihm. Ihre Soldaten werden misstrauisch
Anfangs Februar 1798 übernahm der französische General Brune das Kommando über die Armee in der Waadt. Brune war ein äußerst schlauer Mann voller Listen und Schliche.
Hätten die Berner nur die Papiere und Befehle, die er von Paris mit sich gebracht, durchmustern können! Sie hätten dann gesehen, daß er zwei wichtige Schriftstücke mit sich führte. Das eine war eine Kriegserklärung, die noch einige leere Zeilen aufwies. Wozu? Zum Einsetzen der Begründung des Angriffes, d. h. des Vorwandes. Das andere enthielt einen Aufruf an das Schweizervolk.
In der Waadt standen damals nur etwa 11‘000 und im Berner Jura 8‘000 Franzosen. Es fehlte ihnen zudem an Artillerie, Reiterei und Munition. Auch hatte General Schauenburg, der bei Biel kommandierte, dort noch nicht die richtigen Stellungen bezogen. Wenn die Berner sofort angriffen, so ewar es leicht möglich, daß sie siegten. General von Erlach wußte das.
Brune verstand es aber, sich zu helfen. Er schrieb an die Regenten in Paris:
«Es ist mir, als ob ich euch sagen hörte: Was macht Brune? Warum ist er nicht in Bern? Er verliert Zeit. Aber ich bin ohne Kanonen, Kavallerie und Munition. Was würdet ihr sagen, wenn ich marschierte und geschlagen würde?
Ich ergreife den Ausweg, mit den Bernern vage Unterhandlungen zu führen, bis General Schauenburg die Stellungen bei Biel besetzt hat.»
Zugleich sandte Brune einen Hauptmann zu General von Erlach nach Murten. Der Hauptmann traf dort mitten in der Nacht ein und beteuerte, die Franzosen wünschten mit den Schweizern friedlich zusammenzuleben, deshalb begehre Brune zu unterhandeln.
Was beschloß der Rat von Bern? Es gab in ihm eine Kriegs- und eine Friedenspartei. Die letztere glaubte und hoffte: Wenn wir mit den Franzosen höflich und freundlich umgehen und einige ihrer Wünsche erfüllen, so werden sie das altbernische Gebiet in Ruhe lassen. Der Führer dieser Partei war der Seckelmeister Karl Albrecht von Frisching.
Die Kriegspartei dagegen war überzeugt: Frankreich will auf jeden Fall unser Land in seine Gewalt bringen; deshalb nützt Nachgiebigkeit nichts, im Gegenteil. «Den Krallen des Teufels entgeht man nicht dadurch, daß man sie streichelt>›, so versicherte Schultheiß Niklaus Friedrich von Steiger, das Haupt der Kriegspartei. Steiger war ein Greis mit zitternden Gliedern und einer schwachen, heiseren Stimme. Wer ihn aber reden hörte, konnte bald merken, daß er klug war.
Unglücklicherweise waren die beiden Parteien ungefähr gleich stark. So kam es, daß bald die eine und bald die andere siegte. Das hatte zur Folge, daß rasch nacheinander Beschlüsse und Gegenbeschlüsse gefaßt und Befehle und Gegenbefehle gegeben wurden.
Zuerst siegte die Friedenspartei. Der Rat sandte Frisching und drei andere Männer als Unterhändler nach Payerne zu Brune. Sie verabredeten eine Art von Waffenstillstand für ungefähr vierzehn Tage. Hierauf schrieb Brune nach Paris:
«Bürger Direktoren! ln der Depesche, die ich gestern von Ihnen erhalten habe, befehlen Sie mir, unverzüglich gegen Bern zu handeln. Ich versichere Sie indessen, daß die notwendig gewordene Verzögerung die Streitkräfte des Feindes nicht vermehrt. Sie bewirkt vielmehr deren Auflösung; denn die buntscheckigen Milizen langweilen sich, ermüden und räsonnieren. Umgekehrt wird die französische Streitmacht mit jedem Tage stärken»
Es war so. Die bernischen Soldaten waren willig eingerückt. Sie konnten nun aber nicht begreifen, weshalb ihre Offiziere sie nicht in den Kampf führten. Darum begannen sie, ihnen zu mißtrauen: Wollten sie nicht etwa Verrat begehen?
Unter den bernischen Soldaten entstand Unzufriedenheit. Die einen verlangten: Wir wollen entweder kämpfen oder heimkehren. Andere polterten: Wir sind bereit, das Vaterland zu verteidigen; aber wir wollen unser Leben nicht für die Macht einiger weniger Familien aufs Spiel setzen.
Die verbündeten Orte, müssen ihre Untertanen und die gemeinen Herrschaften freigeben – Sie lassen Bern im Stich
Was taten die verbündeten Orte, die Bern gemahnt hatte und was ging in Ihnen vor?
In Basel kam es im Januar zu einem großen Umschwung: Die Stadt gewährte dem Landvolke völlige Gleichberechtigung. Nun dachte kein revolutionär gesinnter Basler daran, das patrizische Bern zu unterstützen.
Ende Januar beschloß der Rat von Zürich, die verurteilten Leute aus Stäfa zu begnadigen, ihnen Bußen und Kriegskosten zurückzuzahlen und die Waffen wieder auszuhändigen. Die Eingekerkerten kehrten wie im Triumph nach Hause. Kirchenglocken läuteten, Böllerschüsse ertönten, und Feuer brannten. In den Dörfern lief das Volk zusammen und empfing die Freigelassenen mit Ehrenbögen, Inschriften und Kränzen. Weißgekleidete Mädchen teilten Blumen aus, und es flossen Freudentränen. Ein Augenzeuge berichtet:
«Steine hätten mögen gerührt, Felsen erweicht werden. Es war, als ob die Liebe selbst in Menschengestalt gekommen wäre. So etwas sieht und hört man nicht alle Jahrhunderte»
Wenige Tage später (am 5.Februar) sah sich der Rat gezwungen, dem Landvolke zu erklären: Von jetzt an gelten Freiheit und Gleichheit; eine Kommission aus Stadt- und Landbürgern soll eine völlig neue politische Ordnung entwerfen.
Zugleich bot die zürcherische Regierung Truppen auf. Allein die Landleute dachten an das, was sie vor drei Jahren erlebt hatten. Die meisten wollten dem patrizischen Bern nicht beistehen, denn sie meinten noch immer: «Unsere wahren Brüder und Bundesgenossen sind nicht die einheimischen Aristokraten, sondern die Soldaten der französischen Heere ››
So kam es, daß bloß etwa ein Zehntel der Aufgebotenen auf den Sammelplätzen erschien, Im ganzen sandten alle Orte zusammen den Bernern nur 4900 Mann.
Ungefähr zur selben Zeit wie der Rat von Zürich versprachen auch die Regierungen der andern Orte ihren Untertanen neue Verfassungen und Gleichberechtigung. Überdies gaben sie die Bewohner der gemeinen Herrschaften frei. Sie sollten selbständige Orte bilden dürfen.